Medien, Tonträger, neue Technologien – sie beeinflussen seit jeher den Aufbau von Songs und Tracks. Bringt auch das Musikstreaming neue Formate hervor? Eine Spurensuche mit Analogsoul.
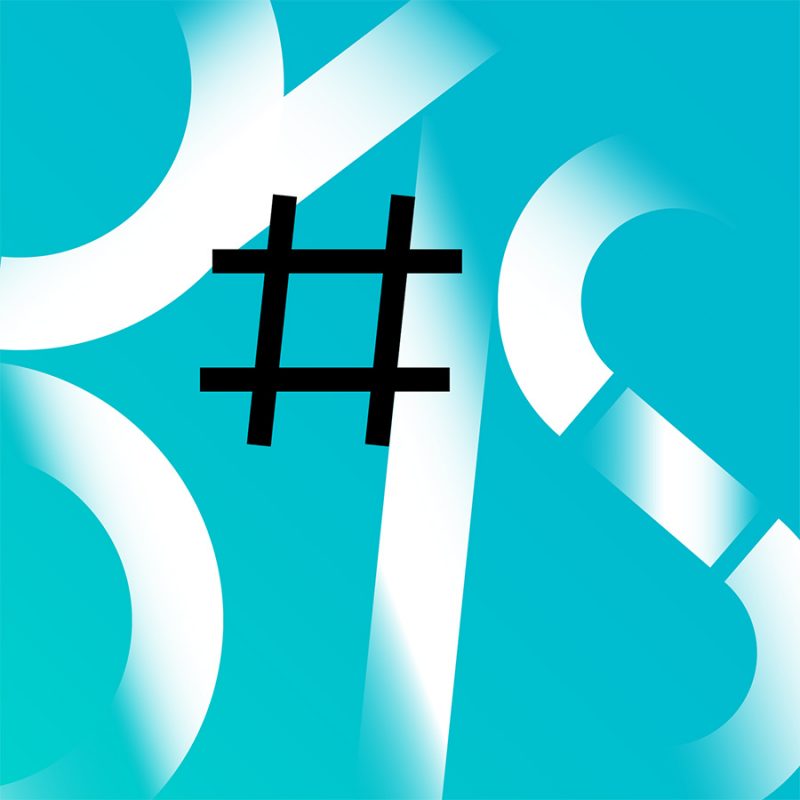
Musikstreaming ist derzeit der Wachstumsmarkt in der Musikwirtschaft. Laut des Bundesverbands Musikindustrie stieg im vergangenen Jahr der Umsatz über die abo- und werbefinanzierten Vertriebskanäle Spotify, Tidal, Apple Music & Co in Deutschland um rund 106 Prozent. Erstmals überholte das Streaming auch den Verkauf von MP3 und anderen digitalen Formaten. Zwar ist die CD aktuell noch das am meisten verkaufteste Tonträgerformat, doch in Zukunft dürften sich den Marktanteile weiter verschieben.
Dabei ist das Streaming nicht unumstritten. Bei Vergütungen zwischen 0,2 bis 0,9 Cent pro Stream-Abruf gab es in der Vergangenheit immer wieder Künstler und Labels, die sich dem jungen Vertriebskanal verweigerten. Es braucht große Reichweiten, um über das massenhafte Streaming einen nennenswerten Betrag zu erwirtschaften. Gerade für kleine Labels und unbekannte Künstler scheint dies wenig rentabel – und doch kann es auch für sie Vorteile bringen. Leipziger Labels sind dem auch keineswegs verschlossen, wie eine kurze Suche zeigt: Kann Records, O*RS, Ortloff, Moon Harbour, Riotvan, Statik Entertainment und Analogsoul sind beispielsweise mit ihren Backkatalogen vertreten. Andreas von Analogsoul erzählt, wie der Stellenwert von Streaming ist:
Andreas von Analogsoul erzählt, wie der Stellenwert von Streaming ist:
„Wie die meisten anderen Künstler und Labels wollen wir unsere Musik gern auf möglichst vielen Plattformen zu niedrigen Schwellen verfügbar machen, damit Leute damit in Kontakt kommen können. Streaming als Verbreitungsweg hat ein paar Facetten, die uns gut gefallen und zusagen: Neben der unmittelbaren Verfügbarkeit und der Tatsache, dass Spotify tatsächlich weltweit genutzt wird, sind das z.B. auch Playlisten. Mit dem Erlösmodell können wir natürlich nicht zufrieden sein, erst recht wenn man sich anschaut, wie groß der Unterschied zwischen Majors und Indies an der Stelle ist. Darüber haben wir ja auch mehrfach gebloggt.“
Ist Streaming mittlerweile für euch wichtiger als Download-Verkäufe – oder eine nette Ergänzung?
„Wirtschaftlich gesehen ist es eine nette Ergänzung. Aber Streaming ist oft der erste Kontakt eines Hörers zu unserer Musik, was aber nicht automatisch eine fette Umwegrendite generiert.“
Wie ist der geschätzte Streaming-Anteil gegenüber Downloads, CDs und Vinyl?
„Von der Menge der Abrufe her ist Streaming unsere größte Kontaktfläche. Vom wirtschaftlichen Ertrag her machen die physischen Tonträger und digitale Donwloads aber den absoluten Großteil unserer Einnahmen aus. Es kommt aber schon vor, dass ein Track, der es in eine wichtige Playlist geschafft hat, mal 100 Euro in einem Monat über Streaming erlöst.“
Auch Markus von Riotvan sieht das Streaming durch die Playlists als gutes Promo-Tool. Wobei „es schon ziemlich krass ist, wenn man sieht, dass man bei einem Album mit 10.000 Streams am Ende vielleicht 20 bis 30 € rausbekommt.“ Teilweise käme man aber auch auf dieselbe Summe wie bei Digital-Verkäufen über Beatport. Für Markus ist das Genre entscheidend: Mit Pop sei über Streaming-Plattformen mehr zu erreichen als mit House-Künstlern wie Panthera Krause – auch wenn es sich dort ebenfalls seit ein bis zwei Jahren steigert.
Bei O*RS sind Streaming und Downloads auf einer Augenhöhe und so bemerkbar, dass es „ein wichtiger Bestandteil zum eher gleichbleibenden Vinyl-Verkauf“ geworden ist. Die Verschiebung ist also spürbar. Aber hat das Streaming als Vertriebsweg bereits solch eine Relevanz, dass es einen künstlerischen Einfluss ausüben könnte?
Bisher brachte jedes Medium und Format bestimmte Vorgaben mit sich, die auch Einfluss auf das Songwriting hatten. Beim Vinyl sind es zwei Seiten mit, je nach Vinyl-Format, unterschiedlich begrenzten Spielzeiten – maximal 23 Minuten pro Seite. Die CD bietet da etwas mehr Spielraum. Das klassische Pop-Radio wiederum fordert kurze, dreiminütige Songs, um gespielt zu werden. In der elektronischen Musik geben DJs sowie die Konventionen von Clubnächten die Track-Strukturen maßgeblich vor, indem Mixparts und Breaks eingebaut werden. Kann auch das Streaming so weit in Song- und Trackstrukturen eingreifen?
Durchaus: Denn obwohl technisch und physisch beim Streaming keine Beschränkungen bestehen, gibt es einen wirtschaftlich interessanten Aspekt: Spotify zahlt pro Stück ab 30 abgespielten Sekunden. Der US-amerikanische Songwriter und Musikprofessor Mike Errico thematisierte dies in einem überaus spannenden Artikel und stellte die These auf, dass Musikstücke zukünftig nur noch 30 Sekunden lang sein werden. Rein wirtschaftlich gesehen kann nämlich ein Album mit vielen kurzen Songs mehr erlösen als eines mit wenigen langen Stücken. Und da professionell agierende Musiker neben künstlerischen Beweggründen auch ihre Einnahmequellen im Blick haben, sind Erricos Gedanken auf dem ersten Blick gar nicht so abwegig.
Einige Bands spielten bereits mit dieser 30 Sekunden-Schwelle. Die englische Indie-Band The Pocket Gods brachte ein Album mit 100 30-sekündigen Songs heraus. Vulfpeck stellten 31 kurze Songs mit Stille online, die in Endlosschleife gespielt werden sollten. Damit verbunden war jedoch eher der Protest gegenüber den mageren Streaming-Ausschüttungen. Die Frage, welche künstlerischen Auswirkungen die wirtschaftlich relevante Spotify-Vorgabe haben kann, wurde nicht diskutiert. Gibt es jetzt nur noch die Refrains? Oder nur die besten Parts eines House-Loops? All der arrangierte Ballast fliegt raus, um einfach auf den Punkt zu kommen bzw. nur die Filetstücke eines Songs zu veröffentlichen? Wir wollten es von einem Musiker wissen, der sowohl im Pop zu Hause ist, aber auch mit experimentelleren Formen arbeitet. Sind für dich spezielle Beschränkungen oder Freiheiten eines Tonträgerformates generell relevant beim Produzieren, Arpen?
Sind für dich spezielle Beschränkungen oder Freiheiten eines Tonträgerformates generell relevant beim Produzieren, Arpen?
„Ja, ganz klassisch. Die Länge einer Seite beim Vinyl zum Beispiel. Ich finde aber Beschränkungen generell interessant – man wird gezwungen umzudenken und sich künstlerisch auch zu einer bestimmten Situation zu positionieren.“
Beim Streaming verdient man eher durch viele kurze Stücke – wäre das ein Impuls für dich anders zu produzieren?
„Nein. Ich verdiene sehr gern Geld mit meiner Musik, aber ich beziehe in mein eigenes Schreiben nicht das Verhältnis zwischen der Track-Länge und dem möglichen Verdienst ein. Bei konkreten Aufträgen ist das etwas anders.“
Ist die Kürze eines von Spotify anerkannten Songs eine Chance zum Veröffentlichen für gelungene Skizzen oder Loops, die sonst nur unnötig in die Länge gezogen werden würden?
„Möglicherweise. Ja, für Loops könnte das interessant sein. Aber wer hört sich ein 45 Sekunden-Loop an und findet das irgendwie befriedigend? Ich denke das wäre dann für Musiker interessant bzw. auch für MCs. Dann müsste man aber auch damit arbeiten können – bzw. sollte es ein Mix-Tool geben, mit dem man mit diesen Loops live auflegen könnte – das fände ich irgendwie hot.“
Arpens Antwort zeigt auf, dass Erricos These den Hörer außen vor lässt. Die Hörgewohnheiten müssten sich fundamental verändern, um kurze Snippets als befriedigendes Musikerlebnis annehmen zu können. Und besonders in der Clubmusik erzeugen erst der langsame Aufbau und die Länge der Tracks und Sets ihre hypnotischen Wirkungen. Unberücksichtigt scheinen auch die künstlerischen Ambitionen der Musiker: Neben den Sounds geht es immer auch um Dramaturgien – und die benötigen einen gewissen Entfaltungsspielraum. Ob sich den Musiker in so drastischer Weise verkleinern lassen, ist mehr als fraglich. Hinzu kommt, dass die Musikwirtschaft trotz der hohen Wachstumsraten des Streamings auch in naher Zukunft ihre Musik auf verschiedenen Tonträgerformaten anbieten dürfte. Und hier würde die 30-Sekunden-Beschränkung von Spotify mit der 46 Minuten-Option des Vinyls kollidieren. Oder zu komplett unterschiedlichen Varianten eines Albums oder einer EP führen, was schwer vorstellbar ist.
Wie hoch schätzt Andreas von Analogsoul die Chance ein, dass sich durch Streaming alte Formate wie Song-Strukturen, EP- und Alben-Zyklen wirklich verändern werden: „Der Song als solcher wird sich vermutlich nicht weit verändern, Strukturen wie Alben werden sich aber zusehends auflösen oder zumindest stark verändern. Ich denke, dass ähnlich wie im Hip Hop oder im elektronischen Bereich viele Interludes, Skits, Intros oder andere Fragmente Teil von Alben werden.“
Wie es klingen könnte, wenn sich Musiker und Labels komplett dem Spotify-Vergütungsstandard hingeben, hat Analogsoul mit der Compilation „#31s“ ausgelotet. Musiker aus dem direkten Label-Umfeld sowie dem erweiterten Umfeld wurden um 31-sekündige Songs und Tracks gebeten, um herauszufinden, was dies künstlerisch hervorbringt. Die 31 Stücke öffnen stilistisch ein weites Feld zwischen Pop, HipHop, House, Electronica und Post-Rock.
Der Umgang mit der Beschränkung ist indes sehr unterschiedlich. Einige Musiker bringen eine eigenständige, ultrakompakte Komposition hervor. Bei anderen klingt es nach dem Ausschnitt von etwas Größerem – die Stücke enden abrupt, wie abgeschnitten. Irgendwo wird ein Break angekündigt und am Höhepunkt runtergefahren. An anderer Stelle ist nur eine kurze eingesungene Strophe zu hören. Es bleiben 31 Fragmente, Outtakes oder Jingles.
„#31s“ zeigt einerseits, wie viel künstlerische Substanz in solch kurze Zeit passt. Andererseits fühlt es sich am Ende immer wie das unbefriedigende Durchskippen einer Compilation-Tracklist in einem Download-Shop an, bei dem nur Snippets vorgehört werden können. Aus wirtschaftlicher Sicht jedoch ist „#31s“ das optimalste Produkt für Musiker und Label – es wurde nicht mehr Dramaturgie und Länge hineingesteckt als notwendig, um bei Spotify entlohnt zu werden. Um diese Diskrepanz ging es den Analogsoul-Betreibern. Darum, dass „in 31 Sekunden zu wenig Zeit bleibt, um einen Gedanken wirklich auszuformulieren. Wir würden gern für mehr als 31 Sekunden bezahlt werden“, heißt es im begleitenden Projekttext. Angesichts der künftig zu erwartenden Verschiebungen bei den Marktanteilen von physischen und digitalen Tonträgern ein durchaus berechtigter Einwand.
Veröffentlicht wurde „#31s“ übrigens konsequenterweise als Spotify-only-Release.

