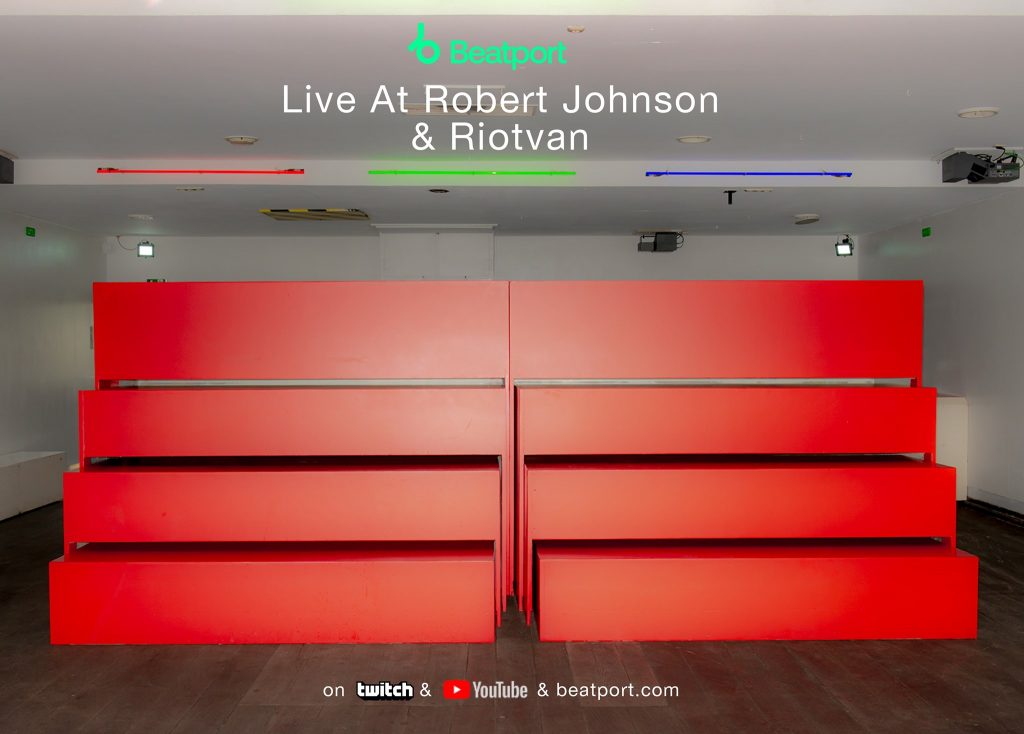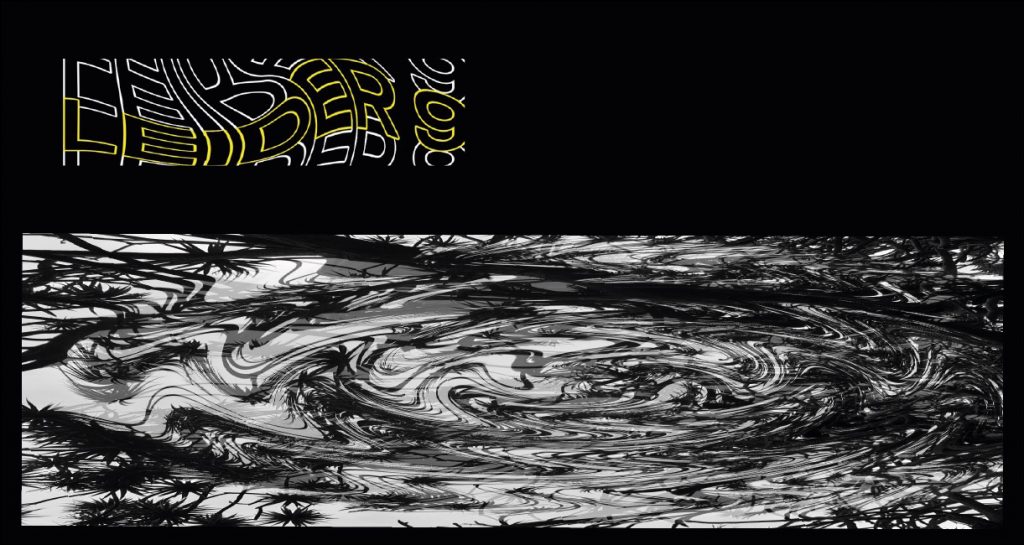Das ehemalige Awareness-Team des mjut hat in einem Blog mehrere Vorwürfe gegen den Club erhoben. Wir haben unter anderem ein Interview mit den Autor:innen des Blogs geführt.
Nachtrag unten (22. September 2021)
Timeline
Am 23. Februar erscheint auf Instagram der erste Post von @nicht__schweigen, einem Account, hinter dem ein Teil des ehemaligen Awareness-Teams aus dem mjut steht. Eine Woche zuvor, am 16. Februar, wurde bereits ein Blog ins Leben gerufen – nichtschweigen.noblogs.org. „Wir schreien auf“ lautet der Titel des ersten Beitrags.
„Wir, das ist ein Teil eines ehemaligen Mjut-Awarenessteams,“ schreiben Nicht Schweigen im ersten Satz. „Wir haben ein Jahr lang geschwiegen, warum wir den Club verlassen haben. […] Jetzt aber hat sich das Mjut zu ‚Seximus in der Clubkultur‘ geäußert – mit einem Statement, das wir so nicht stehen lassen können.“ Nachdem ein Beitrag des mjut am 09. Februar zu unserer „Täter an den Decks“-Recherche in den Augen des ehemaligen mjut-Awareness-Teams das Fass zum Überlaufen bringt, folgt eine Reihe von Beiträgen und Vorwürfen.
„Im Februar 2020 wurde ein Mitglied unseres Teams ‚gekündigt‘ – in Anführungszeichen, weil eine Kündigung ohne Arbeitsvertrag und ohne Kooperationsvereinbarung schlecht möglich ist – als einziges Mitglied, als einzige trans Person im Team,“ schreibt die Gruppe in ihrem ersten Text. „Ideale vertragen sich nicht mit der harten Realität eines Clubs – haben wir gelernt. Eine Awareness-Person pro Schicht für den ganzen Club, eine Ecke im Keller hinter einem Vorhang als Rückzugsort,“ steht in „Awareness trifft Burnout II“ geschrieben. In ihren Texten greifen die Nicht Schweigen-Autor:innen aber nicht nur konkrete Erlebnisse aus ihrer Zeit im mjut auf, sondern bringen regelmäßig strukturelle Einordnungen mit unter. Auch auf diesem Blog wird also Awareness-Arbeit betrieben: Im zweiten Text namens „Misogynie – die ‚Frau‘ ist schuld“ erfolgt beispielsweise eine Einordnung zu Kommunikation, Macht und Misogynie. In weiteren Texten wird die Awareness-Arbeit selbst thematisiert.
Anschließend werden mehrere Posts, verteilt über mehrere Wochen im März und April, veröffentlicht. In den Content Notes und Trigger Warnings sind folgende Stichwörter zu lesen: Sexismus, Transfeindlichkeit, Neoliberale Ausbeutung, Misogynie, Tone Policing, Burnout, Ausbeutung, Diskriminierung und Awareness. Bis heute sind insgesamt sechs Instagram-Posts, beziehungsweise sechs Blogposts veröffentlicht wurden. Der Nicht Schweigen-Instagram-Account hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels 214 Follower:innen.
Parallel dazu, nach einer fünfmonatigen Winterpause – zumindest auf Social Media – meldet sich das mjut nach dem letzten Instagram-Post vom 02. Oktober 2020 am 25. März 2021 zurück. Angekündigt werden die Online-Veranstaltungen re:start talking, re:start listening und re:start raving im Rahmen des Geburtstagswochenendes; ein Online-Panel mit verschiedenen Gäst:innen sowie ein Livestream mit Fokus auf Livemusik und ein dritter Livestream mit Fokus auf elektronische Musik. Zudem wird die zweite „surroundings“-Compilation beworben. Auf die Vorwürfe von Nicht Schweigen wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels nicht öffentlich eingegangen.
Die frohfroh-Redaktion wurde Ende März auf die Vorwürfe, die durch Nicht Schweigen thematisiert wurden, aufmerksam und entschied, das Thema redaktionell aufzugreifen. Ziel war es, beide Parteien anzuhören und die potenziellen Antworten auf unsere Anfragen auf unserem Blog gegenüberzustellen. Im Zuge dessen kontaktierten wir den Nicht Schweigen-Account und baten um ein Interview. Die schriftliche Antwort erfolgte am 4. Mai und ist im folgenden Text zu lesen.
Das mjut wurde durch uns am 1. Juni kontaktiert und wir bekamen zwei Wochen später, am 14. Juni, eine Antwort. Der Inhalt der Antwort und der weitere Kontaktverlauf werden nach dem untenstehenden Interview mit Nicht Schweigen aufgegriffen.
Disclaimer
Es ist keinesfalls unsere Absicht, das mjut zu „canceln“ oder Leser:innen dazu zu motivieren, Hassnachrichten an das mjut zu senden. Wir möchten einen Rahmen schaffen, in dem Clubs und ihre Akteur:innen kritisch hinterfragt werden können und in dem eine Auseinandersetzung mit Diskriminierungsformen stattfinden kann.
Als Online-Magazin für elektronische Musik in Leipzig sehen wir es als unsere Aufgabe, aktuelle Entwicklungen in der Clubkultur und der dazugehörigen Szene vor Ort zu begleiten und aufzugreifen. Wir schreiben nicht nur Rezensionen und Künstler:innenporträts, sondern üben auch Kritik an den vorherrschenden Zuständen. Was wir nicht wollen, ist Einzelpersonen oder ganze Einrichtungen zu ruinieren. Unser Ziel ist es, alle Akteur:innen der Szene anzuhören und auch über schwierige und dabei oft nicht leicht zu lösende Konflikte und Debatten zu berichten.
Klar, wir als frohfroh möchten dabei eine unabhängige Instanz darstellen. Ob das gelingt, in der Vergangenheit immer gelungen ist und gelingen wird, daran arbeiten wir als Redaktion und als Autor:innen. Im Zuge der Recherche für diesen Artikel habe ich jedoch als Autorin einige unangenehme Situationen erfahren müssen, die für mich mehrere Fragen in den Raum geworfen haben: Wie lässt sich innerhalb dieser Subkultur Privatperson von Szeneakteur:in trennen? Können Diskurse über komplexe, durchaus auch unangenehme, Thematiken überhaupt noch stattfinden, wenn das nicht gelingt? Was bedeutet Unabhängigkeit in dieser Szene überhaupt, die so eng vernetzt ist? Wie können wir versuchen, sie im Spannungsfeld eigener Verflechtungen und Überzeugungen zu gewährleisten? Und wie wird uns dabei professionell und privat begegnet?
Konkret: Ich stelle eine professionelle Anfrage an eine der involvierten Parteien und die Kommunikation erfolgt schriftlich per E-Mail. Außerhalb von dieser Kommunikation, in meiner Freizeit und ohne Vorwarnung, werde ich von Einzelpersonen von jener Partei auf meine Recherche angesprochen und unter Druck gesetzt. Ich betone dabei mehrfach, dass ich in diesem Moment nicht über die Recherche sprechen möchte, insbesondere nicht vor Veröffentlichung und nicht in diesem Rahmen – was nicht akzeptiert wird.
Inwieweit habe ich noch Lust und vor allem den Mut, diese Thematik weiterhin zu behandeln und unter meinem Namen einen Artikel zu veröffentlichen? Wenn ich mich mit einer kritischen Recherche als Journalistin in der Clubszene bewege, inwiefern gefährdet das a) meine Freund:innen- und Bekanntschaften und b) mein Dasein als DJ und Veranstalterin? Können es sich Menschen, die nicht anonym bleiben, leisten, unangenehme Themen aufzugreifen und kritische Fragen zu stellen, solange sie Teil der Szene sind und sein möchten?
Dieser ‚Exkurs‘ ist dem Interviewteil vorangestellt, um die Komplexität der gesamten Situation zu verdeutlichen und eine zeitliche Einordnung vornehmen zu können. Und gleichermaßen aufzuzeigen, mit welcher journalistischen Sorgfalt vorgegangen wurde und welche Fragen mich als Autorin in dieser Sache weiterhin beschäftigen. Jetzt kommen wir – endlich – zu den Fragen und Antworten von Nicht Schweigen.
Interview
ff: Euren Texten nach zu urteilen möchtet ihr mit eurer Plattform als Ansprechpartner:innen für all jene agieren, die diskriminierende und anderweitig unangenehme Erfahrungen mit dem mjut gemacht haben. Inwiefern erlauben die bisherigen Strukturen aus dem mjut so eine Auseinandersetzung nicht?
Nicht Schweigen: Es gab keine offizielle, interne Stelle, an die sich mit Kritik gewandt werden konnte. Die Stelle, die sich mit Diskriminierungen auseinandergesetzt hat, waren wir, aber wir fanden bei der Clubleitung und beim Großplenum kein Gehör. Und wenn wir selbst betroffen waren, hatten wir keine Möglichkeit, uns intern auszutauschen. Kritik wurde oft ins Private verlagert, in Mitarbeitendengespräche, die als 1:1-Situation zwischen Clubleitung und betroffener Person stattfanden.
Die gesamte Stimmung gab keine vertrauensvolle Atmosphäre her, in der Kritik offen geäußert werden konnte – und wenn sie im Großplenum, konfrontativ, geäußert wurde, wurde das zu einer „alle gegen die kritisierende Person“-Situation bzw. als „nicht angemessenes Thema“ abgewiegelt.
Kritik, vor allem an sexistischen und transfeindlichen Strukturen wurde als „beschweren“ dargestellt, manchmal auch als „nörgeln“ oder „jammern“. Das Framing war, dass wir „überempfindlich“ seien, anstatt uns um wichtigere Probleme zu kümmern.
Das wurde durch die cis-männliche Leitung verstärkt, die sich – unserer Ansicht nach – am liebsten gar nicht mit struktureller Diskriminierung auseinandersetzen wollte.. Kritik, aber auch persönliche Betroffenheit, kann nicht geäußert werden, wenn zuerst Bildungsarbeit geleistet werden muss, warum das genannte Verhalten überhaupt problematisch ist.
Zu Beginn gab es noch den den Plan, eine Mediation zu ermöglichen, dafür sollte jedoch kein Geld ausgegeben werden und somit verlief sich das im Sande. Einer der Punkte, die wir kritisieren: Das mjut möchte am liebsten nie Geld für emanzipatorische oder teaminterne Maßnahmen zur Verringerung von Diskriminierung ausgeben.
Ihr sprecht zugleich konkrete Situationen und tieferliegende gesellschaftliche Issues an. Wie ordnet ihr eure Plattform ein – als Bildungsplattform für die Mitarbeiter:innen des mjut? Als Bildungsplattform für die Szene im Allgemeinen? Als Outcalling-Plattform?
Als Bildungsplattform für alle, die Interesse haben, sich sowohl diskriminierenden Strukturen, als auch den konkreten Situationen innerhalb dieser zu beschäftigen. Natürlich reden wir vor allem über das, was uns im mjut passiert ist, aber gleichzeitig ist das mjut kein einzigartiger Ort. Die dahinterliegenden, diskriminierenden Strukturen sind allumfassend – eben strukturell. Wir wollen darauf aufmerksam machen, was oft hinter der hübschen, linken Fassade von Clubs stattfindet und was durch Menschen unterstützt wird, die den Club unhinterfragt besuchen.
Ihr hebt in eurem Statement vom 16.2. hervor, dass die einzige trans Person aus dem Awareness-Team gekündigt wurde. Ihr schreibt, dass das auf Transfeindlichkeit zurückzuführen ist, wie könnt ihr das erklären? – bzw. wird im Text vom 28.03. geschrieben: „‚Lass mich in Ruhe, ich hab keinen Bock darauf.‘, war die Antwort, als im Plenum höflich (aber nachdrücklich) darauf bestanden wurde, nicht dauerhaft als Frau misgendert zu werden. Eine Person zu zwingen, in zunehmender Lautstärke die eigenen Pronomen und den eigenen Namen zu wiederholen, um endlich korrekt angesprochen zu werden – und darauf mit Verärgerung zu reagieren (anstatt sich zu entschuldigen und es besser zu machen), ist ein eindrückliches Zeichen dafür, wie ignorant nicht nur mit der Awareness als politischer Struktur, sondern auch mit der Identität der einzelnen Mitarbeitenden, umgegangen wurde.“ Wurde die Auseinandersetzung im Anschluss im Plenum diskutiert? Gibt es Gründe dafür, dass in euren Texten der gesamte Club und nicht einzelne Akteur:innen benannt werden?
Die einzige trans Person im Team wurde in einer semi-öffentlichen Awareness-Telegram-Gruppe des mjut gekündigt (beziehungsweise eine weitere Kooperation ausgeschlossen), als Begründung wurde ihre „Einstellung und Arbeitsweise“ angeführt. Offenstehende Honorare wurden nicht bezahlt.
Das geschah zeitnah an das genannte Großplenum, in dem das Misgendern konsequent übergangen worden ist, ebenso wie die Kritik daran. Es gab keine Auseinandersetzung. Das Großplenum ist dazu da, alle Teile des mjut gemeinsam an einen metaphorischen Tisch zu setzen. Wenn trans Personen an diesem Tisch dauerhaft in ihrer Existenz hinterfragt bzw. negiert werden, sich dabei keine Person unterstützend neben diese stellt und dieses Verhalten als „normal“ wahrgenommen wird, dann ist die strukturelle Transfeindlichkeit zu kritisieren, anstatt einzelne Akteur_innen als „Sündenböcke“ darzustellen. Nicht nur agierende Täter_innen, sondern auch die schweigende Mehrheit, die Betroffene alleine mit der diskriminierenden, übergriffigen Situation lässt, ist ein zu benennendes Problem.
Ihr schreibt im Statement vom 09.03.: „Wenn wir eine Toilette für FLINTA wollten – kümmert euch selbst darum. Wenn wir die Auswahl an sexistischen DJs kritisierten, wurde ‚die DJ-Debatte‘ als zutiefst störend und lästig wahrgenommen – und dies auch so kommuniziert. Machten wir deutlich, dass die Arbeitsbelastung an und über unsere Grenzen ging, wurden wir ausgelacht – wir täten doch nichts, das bisschen Awareness! Wünschten wir uns klare Strukturen, statt ‚macht doch Obst und Klopapier und alles andere auch, was so anfällt!‘ wurde uns fehlende Spontanität und Flexibilität vorgeworfen.“ Mit wem fanden diese Gespräche statt und woran liegt es eurer Meinung nach, dass solche Angelegenheiten im mjut keine Wertschätzung und Aufmerksamkeit bekommen?
Diese Gesprächen fanden sowohl in den Großplena des mjut, als auch im direkten Kontakt zur Clubleitung, statt. Wie wir bereits schrieben, denken wir, dass es daran liegt, dass „Awareness“ als „Feigenblatt des politischen Diskurses“ verwendet wird, ohne sich tiefergehend mit den Bedürfnissen und Strukturen in einer diskriminierenden Realität auseinandersetzen zu wollen. Das führt dazu, dass mit der Gründung und der Schichtübernahme des Awarenessteams die Problematiken „Sexismus“ und „Patriarchat“ als erledigt angesehen wurden, anstatt es als Anfang einer Auseinandersetzung zu sehen. Wir sollten das Ende einer Debatte sein, anstatt als deren Beginn begriffen zu werden. Leider verschwinden diskriminierende Strukturen nicht einfach von Zauberhand, sondern müssen bewusst bearbeitet und reflektiert werden.
Was haltet ihr davon, dass das mjut sich bisher nicht zu euren Statements geäußert hat?
Als Personen, die sich seit über einem Jahr mit dem Kommunikationsverhalten des mjut auseinandergesetzt haben, bevor wir mit Nicht Schweigen begannen, wundert uns dieses Verhalten nicht. Wie bei „Monis Rache“ und der sogenannten „DJ-Debatte“ (eine interne Auseinandersetzung, bei der es um sexistische Texte von DJs ging) scheint das mjut bevorzugt Kritik auszusitzen, statt sich mit ihr auseinanderzusetzen.
Was wünscht ihr euch vom mjut? Wie würde eine wünschenswerte Reaktion auf die Statements aussehen?
Ein „zurück zu den Wurzeln“ des mjut, das als Kollektiv mit Augenhöhe und großen Plänen bezüglich Inklusion und antidiskriminierender Arbeit begonnen hatte. Einsicht der eigenen Fehler, der eigenen, diskriminierenden Strukturen und das ehrliche Vorhaben, es zukünftig besser zu machen.
Wir wünschen uns einen echten, linken Club, der seine Aufgabe als „ein bisschen sichererer Raum“ ernst nimmt, anstatt auf Symbolpolitik zu setzen. Wir wünschen uns einen Raum, in dem Menschen sicher feiern gehen können und sich auch bei Kritik ernsthaft damit auseinandergesetzt wird. Wir wünschen uns eine Anerkennung unserer Arbeit und der Mühe, die wir in die Aufarbeitung stecken, anstatt Diffamierung und persönlicher Angriffe.
Eure Instagram-Beiträge wurden per Privatnachricht über den mjut-Account mit Follower:innen geteilt. Wart ihr in diesem Prozess beteiligt?
Auch wenn uns diese Aktion gerne zugeschoben wird, waren wir daran tatsächlich vollständig unbeteiligt – keine Person von uns hat die Zugangsdaten zum mjut Insta. Wir danken der Person, die das getan hat, dennoch von Herzen und freuen uns über diese sichtbare Solidarität aus den Reihen der aktuellen Mitarbeitenden – wir hoffen, es gab für dich/euch keine Konsequenzen/Sanktionen dafür!
Möchtet ihr Reaktionen teilen, die euch im Zuge eures Statements erreicht haben?
Von Lob bis Kritik war alles dabei. Am meisten hat uns berührt, dass wir Reaktionen bekamen, dass Menschen dankbar sind, dass wir uns damit beschäftigen. Außerdem gab es oft die Reaktion, dass es gut sei, dass sich endlich mit den Strukturen beschäftigt werden würde und Anerkennung für die Arbeit, die wir uns machen. Wir bekamen aus unterschiedlichen Richtungen, auch anderen Clubs, solidarische Nachrichten, das hat uns eher überrascht und gefreut.
Kritik gab es für den Zeitpunkt, mitten in der Pandemie, wenn es um Clubs und Kultur ohnehin „schlecht bestellt sei, und dafür, dass wir anonym schreiben. Damit haben wir uns intern auseinandergesetzt. Wir wollen nicht „den Club zerstören“, sondern Veränderungen. Eben… „nicht schweigen“, statt in falsch formulierter Solidarität, in Passivität zu verharren. Außerdem ein paar persönliche Beleidigungen auf dem Niveau von „Ihr Opfer“, das war aber zu erwarten gewesen.
Gibt es (noch) Fragen, die ihr dem mjut stellen wollt?
Inwiefern setzt ihr euch mit der Kritik intern auseinander? Verfolgt ihr das, was wir schreiben? Erkennt ihr an, dass in dieser Auseinandersetzung viel Arbeit, Mühe und Analyse steckt oder ist es euch egal? Wie könnt ihr unsere Kritik mit eurem linken Selbstbild vereinbaren?
Was wünscht ihr euch von der Leipziger Szene oder der Clubkultur im Allgemeinen?
Weniger Symbolpolitik, mehr Auseinandersetzung. Awarenessteams sind ein Anfang, kein Ende. Wenn wir irgendwann Awarenessteams überflüssig machen wollen, weil der gesamte Club, alle Anwesenden aware ist und Diskriminierung überwunden ist, dann muss daran gearbeitet werden. Awareness ist – als Form der Auseinandersetzung mit diskriminierenden Strukturen -, nichts, was einzelnen Personen überlassen werden soll, sondern Grundaufgabe jeder linken Struktur. Wenn wir herrschaftsfreie Räume wollen, muss daran gearbeitet werden. Das Private ist politisch. Wir wollen eine Auseinandersetzung, eine Auseinandersetzung mit Sexismus, Patriarchat, Transfeindlichkeit, Rassismus, Behindertenfeindlichkeit, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit in den eigenen Räumen. Und dazu gehört als Grundlage die Anerkennung, dass diskriminierende Strukturen real sind und auch „linke“ Räume nicht davor gefeit.
Wenn ihr euch zu weiteren Situationen äußern möchtet, könnt ihr auch auf diese eingehen.
Weitere Situationen werden wir in zukünftigen Texten bearbeiten, um genügend Raum für eine angemessene Analyse haben zu können. Wir möchten auch nochmal drauf hinweisen, dass sich alle Menschen, die auch Probleme mit dem mjut hatten, bei uns melden können. Am liebsten per Email oder auf unsere Instagramseite. Wir sind solidarisch mit allen, die gleiches oder ähnliches erfahren mussten in der Clubszene.
Einordnung mjut
Am 01. Juni kontaktierten wir das mjut und fragten nach einer Stellungnahme zu den Vorwürfen, die durch Nicht Schweigen erhoben wurden. Zudem leiteten wir die Fragen, die Nicht Schweigen in unserem Interview formuliert hatten, an den Club weiter. Eine Stellungnahme erfolgte in der Antwort, die wir am 14. Juni erhielten, nicht. „Wir vom mjut haben derzeit nicht vor eine Stellungnahme zu Nicht Schweigen zu veröffentlichen. Sollte ein Artikel eurerseits veröffentlicht werden, werden wir entsprechend reagieren und eine Stellungnahme bzgl. Nicht Schweigen veröffentlichen – über unsere Kanäle oder mit euch gemeinsam.“
Die Option einer Klärung oder eines Interviews per Mail oder anderweitig schriftlicher Form wurde als unmöglich gewertet, stattdessen wurde uns angeboten, Gespräche mit diversen aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter:innen zu führen, Protokolle durchzulesen und viel mehr. Da dieser Prozessvorschlag einer professionellen Mediation gleichte, zu der wir nicht in der Lage sind, lehnten wir dieses Angebot ab. Wir haben weder die Kapazitäten, noch die Ressourcen, eine solche Aufarbeitungsarbeit mit dem oder für das mjut zu leisten.
Aber: In der dreiseitigen PDF wurden unter anderem die Fragen von Nicht Schweigen durch das mjut beantwortet.
Nicht Schweigen: Inwiefern setzt ihr euch mit der Kritik intern auseinander?
mjut: Wie schon geschrieben ist eine Auseinandersetzung mit dem Blog sehr schwierig. Es hat sich intern eine offene Gruppe gebildet, welche sich mit unseren Werten, einem Verhaltenskodex sowie Kommunikationsstrukturen auseinandersetzt.
Verfolgt ihr das, was wir (die Macher:innen von Nicht Schweigen) schreiben?
Ja, wir haben gelesen was sie schreiben.
Erkennt ihr an, dass in dieser Auseinandersetzung viel Arbeit, Mühe und Analyse steckt oder ist es euch egal?
Wir beschäftigen uns eingehend damit wie mit den durch Nicht Schweigen erhobenen Anschuldigungen umzugehen ist. Dass wir bereit sind in einen Dialog zu treten, zeigen unsere wiederholten Gesprächsangebote an frohfroh. Uns ist der Blog nicht egal, weshalb wir frohfroh auch immer noch anbieten unsere Protokolle offenzulegen. (Anm. d. Red.: Gesprächsangebote von Seiten des mjut, die vor des hier aufgeführten Frage- und Antwortkatalogs stattgefunden haben, gibt es unserer Perspektive nach nicht.)
Wie könnt ihr unsere Kritik mit eurem linken Selbstbild vereinbaren?
In einer patriarchal geprägten Gesellschaft kommt man nicht umhin sich im eigenen Selbstverständnis ständig zu reflektieren. Seit der Veröffentlichung wenden wir viele Kapazitäten auf, um uns mit dem Blog auseinander zu setzen. Es fällt uns aber nicht leicht, weil er in unserer Wahrnehmung widersprüchlich ist und wir diese Widersprüchlichkeit alleine nicht auflösen können. Kritik anzunehmen ist für uns wichtig, denn nur so kann man erreichen sich von systemimmanentem Problem zu lösen und ein durch wahrhaftige Awareness gekennzeichnetes Miteinander zu etablieren. Die Art und Weise wie Nicht Schweigen ihre Kritik publiziert hat, hilft uns in diesem Prozess jedoch nicht. Eine derartig destruktive Kritik erschwert uns vielmehr die Realisierung utopischer Ideale.
Am 18. Juni hakten wir erneut beim mjut nach, um eventuell doch eine schriftliche Stellungnahme zu erhalten und stellten weitere Fragen, die auf den Inhalt der Vorwürfe bezogen waren. Eine Antwort erhielten wir am 01. Juli: „Wir möchten euch mitteilen, dass wir an einem Statement arbeiten. Der Blog ist inhaltlich umfangreich und uns ist wichtig möglichst alle Personen einzubeziehen, welche direkten Bezug zu dem Geschehen haben, das dem Konflikt zugrunde liegt. Dieser Prozess ist sehr zeitaufwendig. Darum möchten wir euch bitten mit einer Veröffentlichung eures Artikels zu warten, bis wir unser Statement erarbeitet haben.“ Weiter heißt es: „Die interne Aufarbeitung mit allen Leuten, die noch bei uns im Team sind und die bei der Entstehung des Konflikts schon im Mjut arbeiteten hat uns sehr geholfen die Vorwürfe, die gegen uns erhoben worden sind, aufzuarbeiten. So hat sich nach und nach der Kontext abgezeichnet, in dem sich der Konflikt entwickeln und derartig zuspitzen konnte. Um unsere Strukturen anpassen zu können, müssen wir ein detailliertes Verständnis für das damalige Klima im Mjut entwickeln. Nur so lässt sich genau beurteilen, was falsch gelaufen ist und was wir verändern müssen.“
Wir haben uns dazu entschieden, das Interview mit Nicht Schweigen als ersten Teil einer (hoffentlich) zweiteiligen Reihe und nach über zwei weiteren Monaten Wartezeit zu veröffentlichen. Wir sind eine eigenständig arbeitende Redaktion und können unsere redaktionellen Veröffentlichungen nicht von ungenauen beziehungsweise nicht vorhandenen Zeitangaben abhängig machen, weshalb wir der Bitte des mjut, mit der Veröffentlichung zu warten, nicht nachkommen können. Selbstverständlich verfolgen wir alle Entwicklungen, halten euch auf dem Laufenden und hoffen, dass dieser Konflikt für alle Parteien ein zufriedenstellendes Ende findet.
Vielen Dank an Jasmin Biber für die Illustration!
Nachtrag vom 22. September 2021: Das mjut hat am 19. September ein Statement veröffentlicht, das sich mit vielen Vorwürfen des „Nicht Schweigen“ Blogs auseinander setzt. Es wird über den internen Aufarbeitungsprozess gesprochen und es wird thematisiert, welche Änderungen der Club und das Kollektiv dahinter vornehmen möchte, um ein inklusiverer Raum zu werden; ein safer space. Das zehnseitige PDF haben wir euch verlinkt.